Psychotherapeutische Methoden
Psychotherapeuten bzw. -therapeutinnen verwenden in ihren Therapien verschiedene wissenschaftlich untersuchte Methoden. Im Folgenden werden einige wichtige Psychotherapie-Verfahren zusammengefasst vorgestellt, um einen Überblick zu bieten, wie individuell und unterschiedlich eine Therapie durchgeführt werden kann.
Gesprächsführung und Motivierung
In Gesprächen mit Patienten bzw. Patientinnen erscheinen oft zugrundeliegende Konflikte oder Widerstände, die in der Therapie bearbeitet werden. Häufig hat eine psychische Erkrankung nicht nur Nachteile, sondern bringt auch Vorteile mit sich. Dies hört sich im ersten Moment vielleicht etwas kontraintuitiv an, ist aber theoretisch durchaus schlüssig. Beispielsweise zieht sich ein Patient mit einer Depression vermehrt zurück, ist traurig und niedergeschlagen. Dadurch erhält dieser Patient jedoch häufiger Aufmerksamkeit oder Beachtung in seinem Umfeld. Möglicherweise gibt es eine Person, die sich um ihn kümmert, ihm Essen bringt oder er rechtfertigt sich selbst damit im Bett bleiben zu können. Diese „Vorteile“ nennt man „sekundärer Krankheitsgewinn“. Häufig ist dies nichts, was der Patient bzw. die Patientin bewusst oder absichtlich tut, sondern eher ein „Beigeschmack“. Hier wäre aus psychotherapeutischer Sicht nicht der goldene Weg, den Patienten bzw. die Patientin zu etwas zu drängen, sondern zusammen die Vor- und Nachteile des Konflikts zu erarbeiten und ihnen Widersprüche zwischen dem aktuellen Verhalten und den Zielen aufzuzeigen. Es ist stets wichtig, dass diese Widersprüche von dem Patienten bzw. der Patientin selbst wahrgenommen und erkannt werden, wofür besodners den Techniken der Gesprächsführung (z.B. motivational interviewing) große Bedeutung zukommen.

Korrigierende emotionale Erfahrungen
Hier steht die Wichtigkeit einer authentischen Patient-Therapeut-Beziehung im Vordergrund. Der Patient oder die Patientin soll durch die Beziehung mit dem Therapeuten oder der Therapeutin neue, positive emotionale Erfahrungen machen und den Unterschied zu früheren negativen Erfahrungen wahrnehmen. Oft beziehen sich diese früheren Erfahrungen auf prägende Bezugspersonen. Wenn beispielsweise ein Patient viele Verluste oder ein sehr instabiles Umfeld erlebt hat, bietet der Therapeut oder die Therapeutin Stabilität und Struktur und kann den Patienten unterstützen stabile Beziehungen aufzubauen und Befürchtungen verlassen zu werden zu reduzieren. Hierbei ist es wichtig, dass diese korrigierenden emotionalen Erfahrungen stets individuell auf den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin angepasst werden.

Aktivitätsaufbau
Gerade Patienten und Patientinnen in depressiven Phasen ziehen sich zurück und reduzieren ihre Aktivitäten. Sie gehen weniger raus, vernachlässigen oft ihre Hobbys oder bleiben den ganzen Tag im Bett liegen. Bei dem Aktivitätsaufbau lernen die Patienten und Patientinnen wieder häufiger aktive Handlungen in den eigenen Tagesablauf einzubauen und durchzuführen. Besonders werden solche Aktivitäten bestärkt, die bei den Patienten und Patientinnen positive Gefühle auslösen. Hierfür werden in der Therapie oft Wochenprotokolle, ähnlich zu Stundenplänen in der Schule, erarbeitet und schöne Aktivitäten eingeplant.
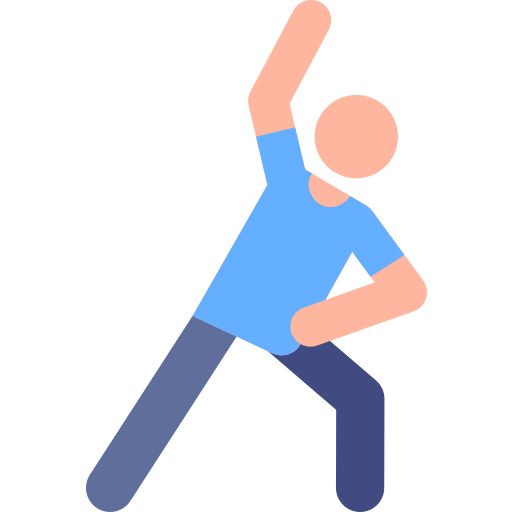
Entspannungsverfahren
Bei den Entspannungsverfahren sollen Patienten und Patientinnen lernen Anspannungsgefühle verbunden mit Angst oder Stress zu verändern. Sie sollen lernen den eigenen Körper zu entspannen. Die bekanntesten Verfahren sind das autogene Training und die progressive Musekelrelaxation (PMR). Diese Verfahren sind vielseitig einsetzbar zum Beispiel bei Nervosität, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen (wichtig: PMR nicht bei Migräne), Magen-Darm-Störungen, Herz-Kreislauf-Störungen, Erröten oder Bluthochdruck. Durch eine regelmäßige Übung von Entspannung soll das allgemeine Erregungsniveau oder auch die allgemeine Anspannung reduziert werden.

Exposition und Konfrontation
Ein oft gezeigtes, nicht hilfreiches Verhalten ist das Vermeidungsverhalten. Im Kontext verschiedener psychischer Störungen, vorzugsweise bei Angststörungen, vermeiden Patienten und Patientinnen bestimmte Situationen, wie zum Beispiel große Plätze mit vielen Menschen, Konflikte, Einkaufen gehen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder auch wichtige Gespräche oder Termine. Mit Patienten und Patientinnen wird häufig zu Beginn eine Angsthierarchie erstellt und identifiziert, welche Situationen die meiste Angst und Anspannung und welche die wenigste auslösen. Dann werden Konfrontationen mit diesen angstauslösenden Situationen geplant. Die Patienten und Patientinnen sollen lernen die Angst auszuhalten und feststellen, dass die Angst von selbst nach gewisser Zeit nachlässt. So soll nach und nach die Angst vor den vermiedenen Situationen überwunden werden.
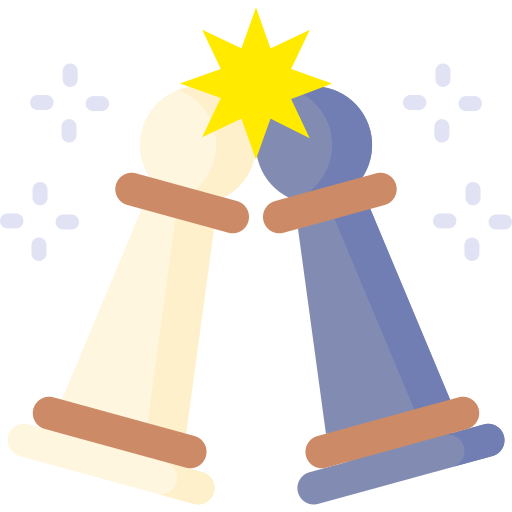
Kognitive Umstrukturierung
Fast immer gehen mit psychischen Störungen wie Depressionen, Ängsten etc. negative Gedanken einher, die die Erkrankungen aufrechterhalten und verschlimmern können. Häufig sind dies Gedanken, in denen sich Patienten und Patientinnen selbst kritisieren und abwerten (z.B. „Ich schaffe das nicht“, „Ich bin ein schlechter Mensch“, „Ich werde verrückt“). Bei der kognitiven Umstrukturierung werden diese negativen Gedanken überprüft und verändert. Es werden neue Sichtweisen und Perspektiven von Situationen erarbeitet. So können Schritt für Schritt Auswege aus den negativen Gedanken gefunden werden.
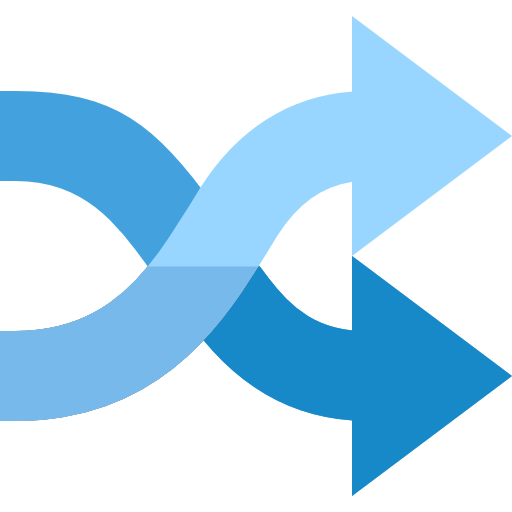
Emotionsregulationstraining
Vielen Patienten und Patientinnen in psychischen Krisen fällt es schwer die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Bei einigen sprudeln diese, wie Wut, Ärger oder auch Trauer, einfach aus ihnen heraus und sind überwältigend stark. Anderen fällt es schwer überhaupt Emotionen zu spüren und fühlen oft eine innere Leere. Besonders im Rahmen von emotional-instabilen Persönlichkeitszügen oder -störungen kommt es häufig zu Stimmungsschwankungen mit starken, kaum kontrollierbaren Gefühlen. Hierfür wurden verschiedene Trainings entwickelt, um zu erlernen, wie Emotionen besser reguliert werden können. Beispielsweise ist die Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) ein sehr bekanntes Verfahren, die besonders im Kontext der Borderline-Störung eingesetzt wird. Hierbei steht die Entwicklung von Skills, also Handlungen und Strategien, die Emotionen regulieren, im Vordergrund. Zudem sollen vermehrt Gefühle identifiziert und benannt werden und gelernt werden, diese adäquat auszudrücken.
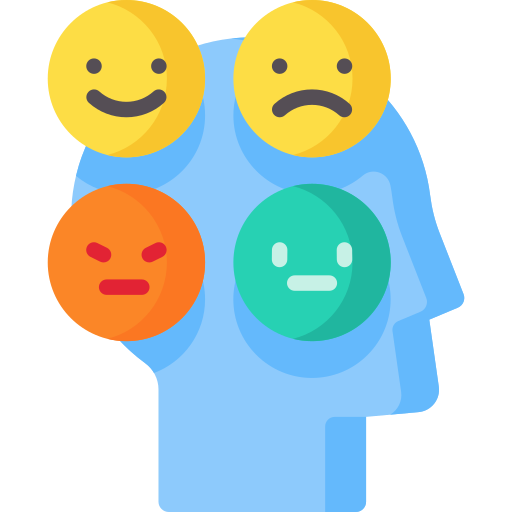
Krisenintervention
Diese Methode soll Menschen helfen, die sich in akuten psychischen Krisen (z.B. Person mit Suizidgedanken) befinden. Hierbei muss vorerst eine Beziehung zu der betroffenen Person aufgebaut werden, woraufhin versucht wird die akute Symptomatik zu lindern. Zudem kann das Einbeziehen des sozialen Umfelds für weitere Unterstützung sehr hilfreich sein. Das Ziel ist es mögliche Auswege aus der Krise aufzuzeigen und gemeinsam Bewältigungsstrategien zu erarbeiten, die selbstständig von der Person angewandt werden können.
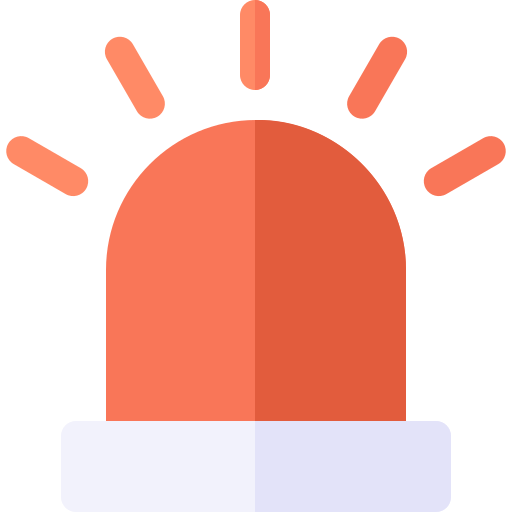
Biofeedback
Beim Biofeedback werden physiologische Prozesse mit technischen Apparaturen (Blutdruckmessgerät, EEG, EKG etc.) gemessen und der Person zurückgemeldet. Zum Beispiel kann die Anspannung der Muskeln gemessen und den Personen in akustischer Form, über einen Ton, zurückgemeldet werden. Die Person wird dann aufgefordert diese Muskelgruppe anzuspannen oder zu entspannen. Mit der Veränderung der Anspannung verändert sich dann der rückgemeldete Ton. Dies soll die Kontrolle eigener Körperfunktionen fördern und Fehlfunktionen (wie eine Verspannung) direkt beeinflussen. Es kann Personen für den eigenen Körper sensibilisieren und bei diversen Störungen helfen, wie zum Beispiel bei Spannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, Epilepsie oder auch Herzrhythmusstörungen.

Gruppenverfahren
Neben psychotherapeutischen Einzelgesprächen können auch Gruppentherapien, die aus einer Gruppe von Patienten und Patientinnen besteht und von meist zwei Therapeuten bzw. Therapeutinnen angeleitet werden, durchgeführt werden. Hier ist der Austausch zwischen Patienten und Patientinnen und das Aufzeigen von eigenen Strategien wirksam. Oft profitieren sie von dem Gefühl und der Erkenntnis mit der psychischen Störung nicht alleine dazustehen. Zudem sind in der Gruppe auch weitere Übungen wie Rollenspiele möglich, die oft gedacht sind, um soziale Fertigkeiten aufzubauen und einzuüben.
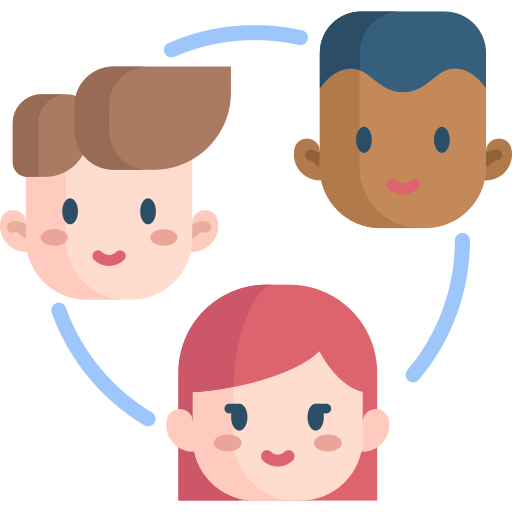
© Psychotherapie als Beruf, Psychotherapie als Beruf
www.psychotherapie-als-beruf.de